 |
|
 |
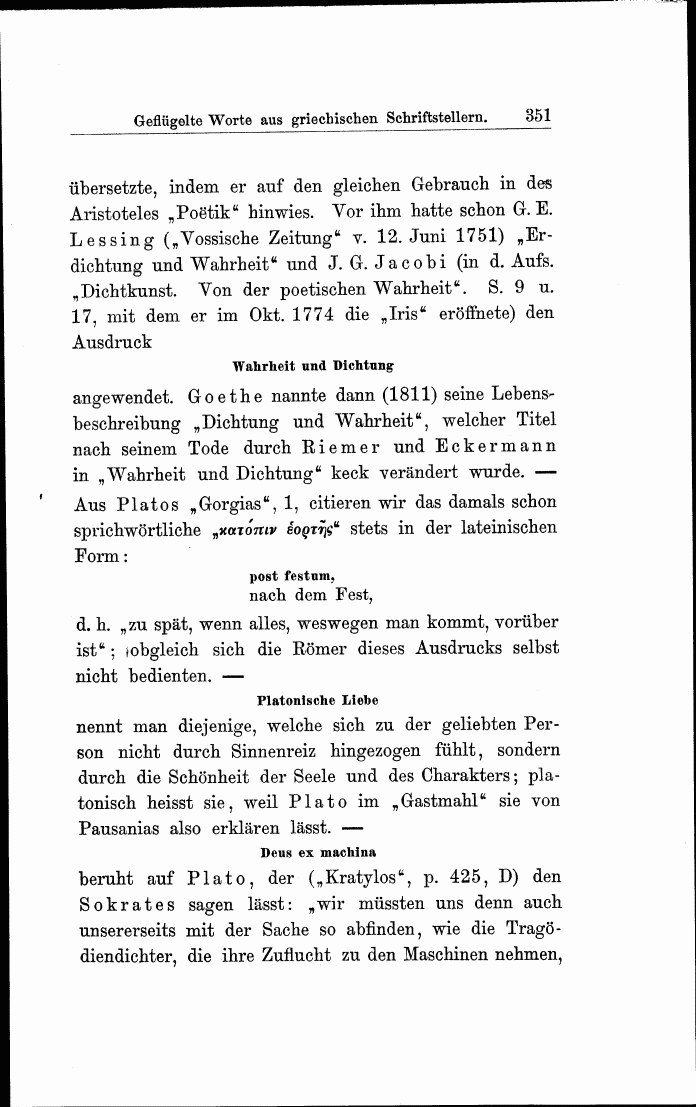
Seite: 351 – << vorige – nächste >> – Übersicht
übersetzte, indem er auf den gleichen Gebrauch in des
Aristoteles "Poëtik" hinwies. Vor ihm hatte schon G. E.
Lessing ("Vossische Zeitung" v. 12. Juni 1751) "Erdichtung
und Wahrheit" und J. G. Jacobi (in d. Aufs.
"Dichtkunst. Von der poetischen Wahrheit". S. 9 u.
17, mit dem er im Okt. 1774 die "Iris" eröffnete) den
Ausdruck
Wahrheit und Dichtung
angewendet. Goethe nannte dann (1811) seine Lebensbeschreibung
"Dichtung und Wahrheit", welcher Titel
nach seinem Tode durch Riemer und Eckermann
in "Wahrheit und Dichtung" keck verändert wurde. --
Aus Platos "Gorgias", l, citieren wir das damals schon
sprichwörtliche [Greek **] stets in der lateinischen
Form:
post festum,
nach dem Fest,
d. h. "zu spät, wenn alles, weswegen man kommt, vorüber
ist"; obgleich sich die Römer dieses Ausdrucks selbst
nicht bedienten. --
Platonische Liebe
nennt man diejenige, welche sich zu der geliebten Person
nicht durch Sinnenreiz hingezogen fühlt, sondern
durch die Schönheit der Seele und des Charakters; platonisch
heisst sie, weil Plato im "Gastmahl" sie von
Pausanias also erklären lässt. --
Deus ex machina
beruht auf Plato, der ("Kratylos", p. 425, D) den
Sokrates sagen lässt: "wir müssten uns denn auch
unsererseits mit der Sache so abfinden, wie die
Tragödiendichter, die ihre Zuflucht zu den Maschinen nehmen,
Seite: 351 – << vorige – nächste >> – Übersicht